- Im Test: 55 Mineralwässer der Sorte "Classic", darunter fünf mit Bio-Auslobung und insgesamt zehn Produkte, die für die Zubereitung von Säuglingswasser geeignet sind.
- Ergebnis: 29 Produkte sind mit "sehr gut" empfehlenswert.
- Mineralwasser aus der Region schont die Umwelt: 13 Marken im Test werden zum Großteil in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern um den Quellort verkauft.
- In der Kritik: Aus unserer Sicht zu viel enthaltenes Bor, Nickel, Uran oder Flourid. Minuspunkte vergeben wir außerdem für erhöhte Gehalte von Abbauprodukten mindestens eines Pestizids sowie für Süßstoffe.
Aktualisiert am 19.12.2024 | Versickert Regenwasser im Boden, wird es auf dem Weg durch die Gesteinsschichten auf natürliche Art gefiltert, bis es sich schließlich in unterirdischen Wasserreservoirs sammelt. Auf seiner Reise reichert es sich je nach Bodenbeschaffenheit in der Quellregion mit mehr oder weniger vielen Mineralien und Spurenelementen an.
Aber nicht jedes Wasser, das aus der Erde gepumpt wird, darf sich "natürliches Mineralwasser" nennen. Nur aus unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen stammendes darf diese Bezeichnung tragen und gilt dann als "ursprünglich rein".
Mineralwasser muss "ursprünglich rein" sein
Allerdings können auf natürlichem Wege auch unerwünschte Bestandteile ins Wasser geraten – wie viel wovon erlaubt ist, regelt in Deutschland die Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (vereinfacht: Mineral- und Tafelwasserverordnung). Manche Stoffe wie Bor, Nickel und Uran sind zwar natürlichen Ursprungs, können in bestimmten Mengen aber schädliche Effekte haben.
Andere, beispielsweise Pestizide, hat der Mensch in die Böden eingebracht, durch die das Wasser sickert. Ihre Abbauprodukte können so schließlich auch in unseren Wasserflaschen landen. Sogar Süßstoffe, die unter anderem über menschliche Ausscheidungen ins Abwasser und so in den Wasserkreislauf gelangen, finden sich im Mineralwasser wieder. "Ursprünglich rein" ist das aus unserer Sicht aber nicht.

Keine erhöhten Nitratgehalte nachgewiesen
Entwarnung können wir immerhin in Sachen Nitrat geben. Auch wenn der Nitrateintrag in die Böden, unter anderem durch Düngemittel in der Landwirtschaft, in Deutschland weiterhin hoch ist, fand das Labor in 28 Wässern nur Spuren davon.
Keine der betreffenden Proben schöpfte die Grenzwerte der Mineralwasserverordnung auch nur zu 50 Prozent aus. Selbst die Hälfte der strengeren Anforderungswerte des SGS-Instituts Fresenius für Bio-Wässer überschreiten die entsprechend ausgelobten Produkte nicht.
Natürliche Verunreinigungen in Wasser im Test
Zweimal ergaben die Laboranalysen eine Belastung mit Bor. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) haben Langzeituntersuchungen bei Tieren entwicklungs- und reproduktionstoxische Effekte durch Borverbindungen gezeigt.
Aufgrund dessen empfiehlt das BfR, sich für Bor in Mineralwasser am Grenzwert der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zu orientieren, die die gesetzlichen Anforderungen für Leitungswasser definiert, und nicht an dem in der Mineralwasserverordnung festgeschriebenen, deutlich höheren Wert.
Dieser Empfehlung folgen auch wir bei unserer Bewertung und werten aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes bereits bei einer Ausschöpfung von mehr als der Hälfte des TrinkwV-Grenzwerts ab.
Zu viel Nickel und Uran entdeckt
Auch Gehalte an Nickel kritisieren wir, die den in der Mineralwasserverordnung festgelegten Grenzwert zu mehr als 50 Prozent ausschöpfen. Zwar nehmen Menschen den Großteil an Nickel nicht über Wasser auf, dennoch ist das Spurenelement in der Natur weit verbreitet und gelangt mit vielen verschiedenen Lebensmitteln in unseren Körper.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfiehlt, die tägliche Nickelaufnahme zu beschränken, und beruft sich dabei auf eine Sachverständigeneinschätzung, dass die derzeitige ernährungsbedingte Nickelexposition insbesondere bei jungen Menschen Anlass zur Sorge geben kann.
Zu hohe Uranwerte in Bio-Wasser
Aus unserer Sicht zu hohe Uranwerte sind in Classic-Mineralwasser ebenfalls unerwünscht – und führen zu Minuspunkten. Das radioaktive Schwermetall ist zwar ein natürlicher geologischer Bestandteil. Es kann allerdings die Leber und insbesondere die Nieren schädigen, weshalb Lebensmittel wissenschaftlichen Empfehlungen zufolge so wenig Uran wie möglich enthalten sollten.
Da es sich beim betroffenen Produkt um ein Mineralwasser mit Bio-Auslobung handelt, an das Verbraucherinnen und Verbraucher zu Recht höhere Ansprüche stellen, legen wir für die Bewertung den Anforderungswert des SGS-Instituts Fresenius für Mineralwasser mit Bio-Qualität von zwei Mikrogramm Uran pro Liter zugrunde. Der im Labor gemessene Urangehalt schöpft diesen zu mehr als der Hälfte aus.
Fluorid als Problem in Sprudelwasser?
Die Etiketten von zehn Mineralwässern im Test besagen, dass sie für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet sind. Für diese Wässer sind die Grenzwerte der Mineralwasserverordnung in vielen Fällen strenger – auch für Fluorid. Zweimal schöpfen gemessene Gehalte im Test den Wert zu mehr als 50 Prozent aus.
Fluorid gilt zwar schon für die Kleinsten als wirksame Kariesprophylaxe, doch Kinderärzte und -zahnärzte empfehlen vor dem Durchbruch des ersten Zahnes eine Nahrungsergänzung mit einem Kombipräparat aus Vitamin D und Fluorid. Darüber erhalten Säuglinge genau die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlene Menge an Fluorid.
Zwar sind keine unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen zu befürchten, dennoch sollten die Allerkleinsten aus unserer Sicht über das Wasser, das zur Zubereitung der Anfangsnahrung verwendet wird, nicht zusätzlich dauerhaft relevante Mengen an Fluorid aufnehmen. Eine dauerhaft zu hohe Fluoridaufnahme kann im schlimmsten Fall die Elastizität der Knochen beeinträchtigen.
Pestizidmetaboliten in Wässern im Test
Was ist außerdem aufgefallen? In sechs überprüften Wässern – darunter auch eines für Säuglingsnahrung – fand das Labor aus unserer Sicht erhöhte Gehalte von Abbauprodukten mindestens eines Pestizids. Der Einsatz von Pestiziden, vor allem in der konventionellen Landwirtschaft, belastet die Böden immer stärker.
Zwar geht von den nachgewiesenen Metaboliten keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung aus, doch sie überschreiten den Orientierungswert für Pestizide der entsprechenden Verwaltungsvorschrift, den wir bei ÖKO-TEST auch für die Bewertung der Abbauprodukte anlegen.
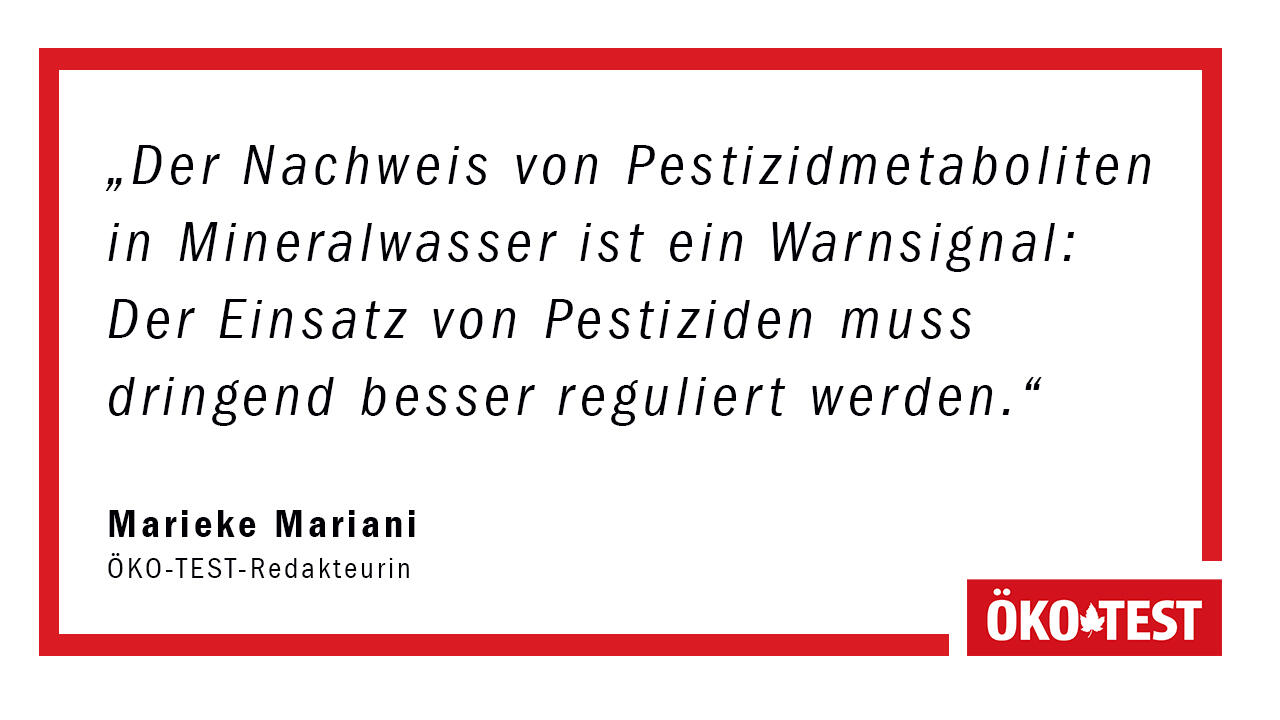
Ursprünglich rein? Leider nein
Auch Süßstoffe, von denen das Labor einen oder mehrere in fünf Wassermarken nachgewiesen hat, trüben aus unserer Sicht die "ursprüngliche Reinheit". Viele Süßungsmittel, die wir zum Beispiel über Softdrinks aufnehmen, scheidet der Körper wieder aus. Kläranlagen filtern diese Stoffe nur unzureichend aus dem Abwasser, sodass sie auf diesem Weg sogar in tiefer gelegene Grundwasserschichten und ins Mineralwasser gelangen können.
Diese Wässer erfüllen unserer Ansicht nach nicht die Anforderungen der "ursprünglichen Reinheit" – ihr Gesamturteil kann nicht besser sein als "ausreichend".
Welche ist die umweltfreundlichste Verpackung?
Kommen wir auf die Flaschen zu sprechen. Mehrwegflaschen aus der Region sind laut Umweltbundesamt die umweltfreundlichste Verpackung für Mineralwasser. Glasflaschen können meist öfter wiederbefüllt werden als die aus Kunststoff. Dennoch verkaufen Discounter, Supermärkte und Drogerien ihre Eigenmarken bevorzugt in PET-Einwegflaschen.
Trotz Pfand ist aus unserer Sicht das ständige Neuproduzieren und Schreddern ökologisch weniger sinnvoll, weshalb Einwegplastikflaschen grundsätzlich Punktabzug erhalten. Immerhin konnten uns alle Hersteller belegen, dass sie 50 bis 100 Prozent Plastik aus dem Wertstoffkreislauf einsetzen.
Diesen Test haben wir zuletzt im Jahrbuch für 2025 veröffentlicht. Aktualisierung der Testergebnisse/Angaben für das Jahrbuch Kinder und Familie für 2025 sofern die Anbieter Produktänderungen mitgeteilt haben oder sich aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Bewertung von Mängeln geändert oder wir neue/zusätzliche Untersuchungen durchgeführt haben.
Medium-Mineralwasser bei ÖKO-TEST
Für unser Juni-Magazin 2023 haben wir 50 Medium-Mineralwässer aus verschiedenen Regionen Deutschlands getestet. Der Test zeigte: Auch besondere Auslobungen garantieren keine absolute Freiheit von umstrittenen Stoffen. Insgesamt schnitten 24 Produkte mit Bestnote ab. Mehr dazu lesen Sie, wenn Sie auf den folgenden Kasten klicken:
Weiterlesen auf oekotest.de:
- Wassersprudler-Test: Welche Modelle sind ihr Geld wert?
- Kaffeepads im Test: Gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe gefunden
- O-Saft so teuer wie nie: Sind die Orangensäfte im Test ihr Geld wert?
- Smoothies im Test: Mehr als die Hälfte mit Pestiziden belastet
- Stilles Wasser im Test: Teils trüben Schadstoffe den Genuss
- Elektrolyte: Warum wir sie brauchen – und was Präparate taugen









