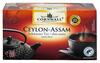- Im Test: 24 Schwarztees, darunter zehn Bio-Produkte. Bezahlt haben wir zwischen 1,13 Euro und 13,80 Euro für je 100 Gramm Tee.
- Nur an zwei überprüften schwarzen Tees haben wir nichts auszusetzen – weder an den Inhaltsstoffen noch am Anbau. Sie schneiden mit "sehr gut" ab.
- Pestizidrückstände sind ein Problem in Tees. Das von uns beauftragte Labor hat insgesamt zwölf verschiedene Spritzgifte gefunden. Das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) stuft viele von ihnen als "hochgefährlich" ein.
- Im Bio-Anbau sind chemisch-synthetische Spritzgifte verboten. Heißt: Auch die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Feldern kommen nicht mit den teils gefährlichen Giftstoffen in Kontakt.
- Kritik gibt es auch für Verunreinigungen durch Chlorat und Pflanzengifte.
Wie kann es sein, dass Tee in unseren Tassen landet, der Pestizide enthält, die in der EU verboten oder nicht mehr zugelassen sind? Nun ja, die Pestizide sind nur im Anbau verboten – Rückstände von eben diesen im Produkt sind erlaubt. Ziemlich bizarr.
In anderen Ländern mit lascheren Vorschriften werden sie weiter gespritzt. Und so konsequent ist die EU eben nicht, dass sie auch den Import von Lebensmitteln verbietet, die mit exakt diesen Spritzgiften belastet sind. So kommen also auch immer wieder Pestizide, die unsere Landwirte hier längst nicht mehr spritzen dürfen, auf unsere Teller – oder in unsere Tasse.

Kritik an Pestiziden in schwarzen Tees
Von den insgesamt zwölf Spritzgiften, die das von uns beauftragte Labor in den 24 schwarzen Tees nachgewiesen hat, sind fast alle vom Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) als "hochgefährlich" eingestuft. Sechs davon sind bei uns verboten oder nicht mehr zugelassen – und das aus gutem Grund.
Beispiele gefällig? Da ist das unter Krebsverdacht stehende und reproduktionstoxische Insektizid Thiacloprid. Und das hoch bienengiftige Insektizid Clothianidin. Oder das Spritzgift Propargit, das von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) als "vermutlich krebserregend" beurteilt wird.
Zwar derzeit in der EU im Anbau erlaubt, aber hoch umstritten ist das Herbizid Glyphosat, das im Teeanbau offenbar flächendeckend gespritzt wird. Es steckt in jedem (!) hier geprüften konventionell angebauten Tee.
Wechselwirkung verschiedener Pestizide kaum erforscht
Alle gemessenen Pestizidrückstände bewegen sich weit unterhalb der Mengen, die gesetzlich zugelassen sind, wir bewerten sie als "Spuren". Sie sind nicht akut giftig.
Wir haben Pestizide in den Teeblättern prüfen lassen und nicht im Aufguss. Aufgrund der geringen Mengen, den vermutlich nicht vollständigen Übergängen in den Aufguss und der Verdünnung durch das Wasser in der Tasse dürften die Mengen, die Teetrinker aufnehmen, vergleichsweise klein sein. Allerdings ist die Wechselwirkung verschiedener Pestizidspuren bislang wenig erforscht.
Und: Viel fataler und toxischer als für uns sind diese Giftstoffe für diejenigen, die sie in den Anbauländern spritzen – in Indien, Sri Lanka oder Malawi etwa. Denn die Pestizide, die wir für uns hier im Anbau als zu toxisch, zu giftig für uns und/oder die Umwelt bewerten, die sprühen die Menschen in anderen Ländern häufig ganz ohne Schutzkleidung – dazu später mehr.
Spitzenwert in diesem Test sind sieben verschiedene Pestizide in einem Produkt – darunter zwei, die in der EU im Anbau nicht zugelassen sind.
Schwarzer Tee: Chlorat und Pflanzengifte gefunden
Neben Pestizidrückständen kritisieren wir weitere unerwünschte Inhaltsstoffe in Tees im Test:
- Chlorat: Das von uns beauftragte Labor hat einmal einen Gehalt an Chlorat gemessen, der den gesetzlichen Grenzwert deutlich überschreitet. Chlorat kann über gechlortes Trinkwasser oder Reinigungsmittel in Lebensmittel gelangen. Über einen längeren Zeitraum in zu hohen Gehalten aufgenommen, kann es die Aufnahme von Jod hemmen und die Schilddrüse schädigen.
- Pflanzengifte: Auch sie sind eine ungewollte Verunreinigung. Die Pyrrolizidinalkaloide gelangen über Beikräuter, die versehentlich mitgeerntet werden, in den Tee. Zwei überprüfte Produkte schöpfen den gesetzlichen Grenzwert um mehr als 50 Prozent aus.
Das könnte Sie auch interessieren: Tiefkühlkräuter: Labor stößt auf krebserregende Pflanzengifte
Im Anbau von Tee gibt es massive Probleme
Chlorat, Pflanzengifte und Pestizide im morgendlichen Tee können einem schon einmal die Laune verderben. Das größte Problem sind aber nicht die möglichen Rückstände in unserer Tasse, sondern die Bedingungen, unter denen viele der Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen, etwa in Indien, Sri Lanka oder Kenia, arbeiten.
Denn die Spritzgifte, die bei uns aus gutem Grund im Anbau verboten sind, die spritzen viele von ihnen ohne Schutzkleidung. Die Folgen können Vergiftungserscheinungen sein, bis hin zum Tod – 11.000 Menschen sterben weltweit jährlich an Pestizidvergiftungen.
Hinzu kommt: Die Arbeiterinnen pflücken häufig im Akkord und bekommen am Ende des Tages oft so wenig Geld, dass sie noch nicht einmal die Kosten für Unterkunft und Lebensmittel decken können. Von existenzsichernden Löhnen, die auch Ausgaben für Bildung, medizinische Versorgung und Beförderungsmittel sowie Rücklagen für Notsituationen umfassen, sind diese Beträge weit entfernt.

Fünf schwarze Tees im Test fallen durch
Deswegen wollten wir von den Anbietern im Test genau wissen, wie es um ihre Bemühungen in Sachen faire Arbeitsbedingungen steht. Wir haben ihnen einen umfangreichen Fragebogen geschickt, den sie beantworten sollten – und jede Antwort sollten sie natürlich glaubhaft belegen.
Dafür müssen die Anbieter erst einmal eins: ihre komplette Lieferkette im Blick haben und offenlegen. Das hat mehr als die Hälfte der Anbieter im Test getan. Immerhin, das ist gut. Denn Transparenz in der Lieferkette ist der grundlegende erste Schritt für bessere Arbeitsbedingungen.
Auf ganzer Linie haben uns aber nur zwei Anbieter überzeugt. Sie schneiden im Testergebnis Teeanbau und Transparenz mit "sehr gut" ab.
Das Fazit des Tests: Unerwünschte Inhaltsstoffe und fehlende Transparenz in Sachen Lieferkette und Teeanbau haben zur Folge, dass fünf schwarze Tees im Test mit "ungenügend" durchfallen. Viele Sorten schneiden außerdem mittelmäßig ab – und nur zwei erhalten die Bestnote.
Wissen: Was können Fairtrade und Co.?
- Fairtrade kennzeichnet Waren, bei deren Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten werden. Ziel ist eine nachhaltige Veränderung der Wertschöpfungsketten. Trotz Fairtrade-Mindestpreis und Fairtrade-Prämie sind die Löhne auch bei Fairtrade noch nicht existenzsichernd. Um das zu ändern, arbeitet Fairtrade seit 2017 an einer Strategie für eine bessere Bezahlung.
- Naturland zertifizierte Betriebe müssen nicht nur strengere Anforderungen erfüllen als EU-Bio-Betriebe, sondern auch die Naturland-Sozialrichtlinien befolgen. Diese sehen unter anderem die Einhaltung der Menschenrechte, angemessene Unterkünfte, Arbeitssicherheit, Sozialleistungen und medizinische Versorgung vor.
- Der Rainforest-Alliance-Standard steht ebenfalls für die Einhaltung bestimmter ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Kriterien. Die Zertifizierung soll die Teebauern dabei unterstützen, den Anbau profitabler und langfristig widerstandsfähiger zu gestalten. Wer nachhaltiger produziert, kann einen Mehrpreis erhalten. An einer Strategie für existenzsichernde Löhne arbeitet auch die Rainforest Alliance.
Weiterlesen auf oekotest.de:
- Orangensaft im Test: Nur eine Marke ist "sehr gut"
- Früchtetee im Test: Bedenkliche Pestizide in einigen Tees entdeckt
- Kräutertee-Test: Pflanzengifte und verbotenes Spritzmittel gefunden
- Mineralwasser-Test: 24 von 50 Medium-Wässern sind "sehr gut"
- Glühwein im Gratis-Test: Welche Glühweine sind die besten?
- Karottensaft im Test: Ist Karottensaft gesund?