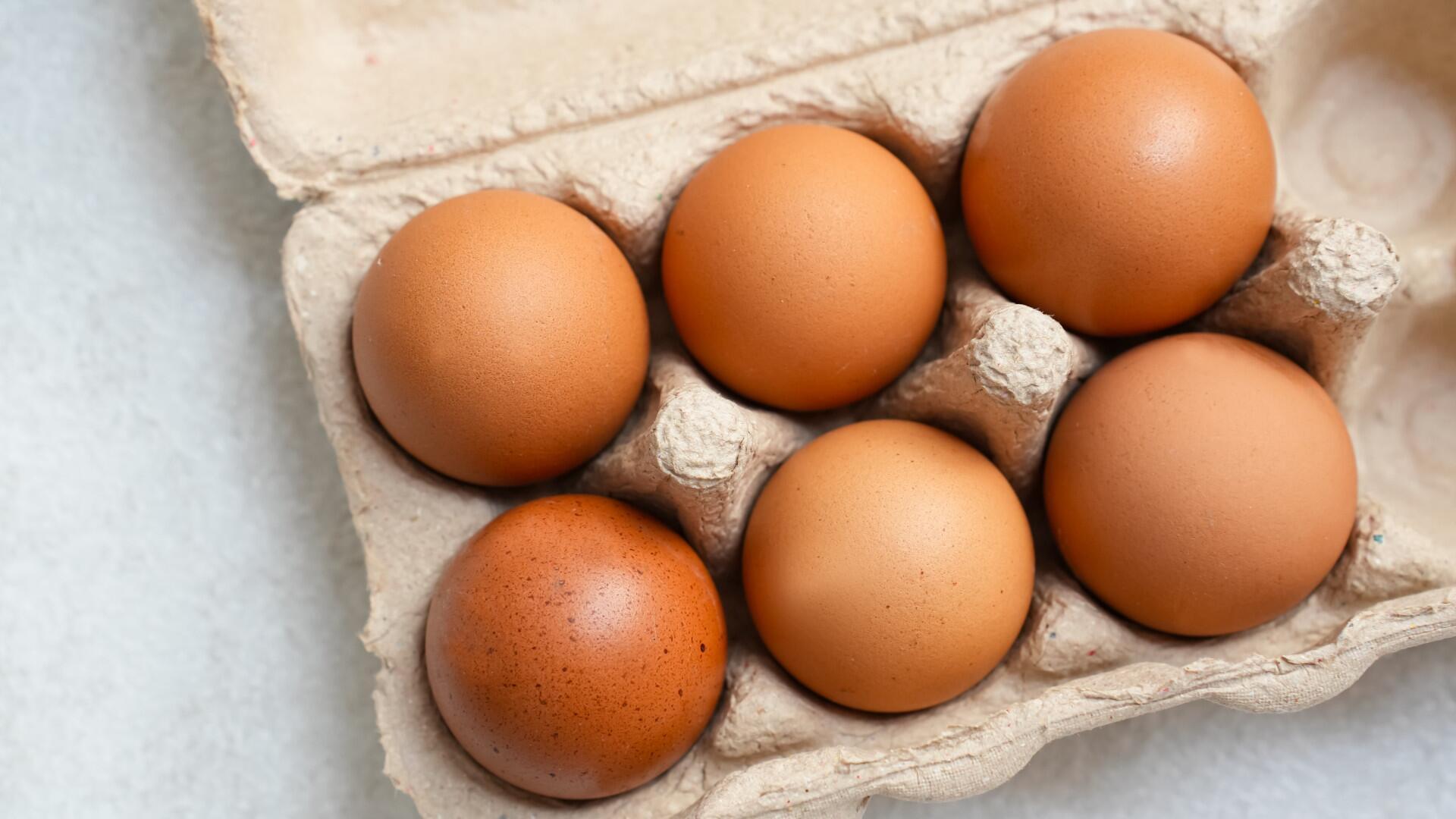Der Verzehr von Meeresfrüchten wird schon länger in Zusammenhang mit hohen PFAS-Werten im Blut der europäischen Bevölkerung gebracht. Doch wie belastet sind Fische, Krabben und Muscheln in der deutschen Nord- und Ostsee wirklich? Und was bedeutet das für die Menschen, die diese essen?
Um das herauszufinden, hat die NGO Greenpeace im Juni dieses Jahres 17 Meerestierproben eingekauft und auf PFAS analyisieren lassen. Die Ergebnisse wurden nun veröffentlicht.
Warum sind PFAS ein Problem?
Doch was sind PFAS eigentlich? Das Kürzel steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Sie bilden eine große Familie von mehreren tausend industriell hergestellten Stoffen, die wasser-, schmutz-, fett- oder ölabweisend sind. Deshalb kommen sie in vielen Alltagsgegenständen wie beispielsweise beschichteten Pfannen, Regenjacken und Kosmetik vor. Die Verbindungen sind extrem langlebig, mobil und nahezu unzerstörbar: Nicht umsonst nennt man PFAS auch Ewigkeitschemikalien.
Das Problem daran: Die Alkylverbindungen werden mit einer Reihe gesundheitlicher Risiken in Verbindung gebracht. Manche PFAS könnten die Leber schädigen, andere das Immunsystem beeinträchtigen, einige werden sogar verdächtigt, Krebs zu erzeugen.
Proben überschritten Grenzwerte
Studien weisen auf die weitreichende Verbreitung von PFAS in der Umwelt hin. Auch in Meeren kommen PFAS-Verbindungen vor. Sie gelangen über industrielle Einleitungen, Abwässer und atmosphärische Einträge in Böden und Gewässer. Dort angekommen reichern sich einige PFAS-Verbindungen in Meeresorganismen an.
Um zu prüfen, wie groß das Problem in der Nord- und Ostsee ist, hat Greenpeace Makrelen, Schollen, Heringe, Schellfische, Steinbutt, Seezungen, Krabben und Miesmuscheln auf Fischmärkten, Kuttern und in Fischläden gekauft und diese auf ihre PFAS-Belastung untersucht. Das Ergebnis: Die Laboranalysen zeigen, dass alle Proben PFAS-belastet sind. Einzelne Proben überschritten geltende EU-Grenzwerte um das bis zu Neunfache.
So enthält jede Probe zwischen einer und sieben quantifizierte PFAS-Verbindungen. Insgesamt wurden neun der 32 untersuchten PFAS-Chemikalien in Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen. Besonders häufig und in hohen Konzentrationen tritt die giftige Substanz Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) auf.
Die PFAS-Belastung war am höchsten bei Steinbutt, Hering und Scholle. Im Durchschnitt lag die gesamte Belastung pro Meerestier in der Reihenfolge Steinbutt > Krabben > Scholle > Heringe > Makrele > Schellfisch > Seezunge > Muscheln.
PFAS in Fisch: Gesundheitliche Risiken möglich
Doch was bedeutet das für die PFAS-Belastung der Menschen, die die Meerestiere verzehren? Die Nahrungsaufnahme ist erwiesenermaßen eine der Hauptquellen für die Exposition mit PFAS-Chemikalien. Meerestiere wurden als wichtige Quellen von PFAS für Menschen identifiziert. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) können insbesondere langkettige PFAS in Fisch und andere Meerestiere bis zu 86 Prozent der PFAS-Exposition durch die Nahrung bei Erwachsenen darstellen.
Greenpeace hat deshalb die gemessenen PFAS-Konzentrationen in den untersuchten Meerestieren mit der von der EFSA festgelegten tolerierbaren wöchentlichen Aufnahmemenge (TWI) verglichen.
Das Ergebnis: Ein Erwachsener mit einem durchschnittlichen Körpergewicht von 77,7 kg würde bereits beim Verzehr einer 150-Gramm-Portion einiger der getesteten Meerestiere die TWI-Grenzwerte für PFAS um bis zu 40 Prozent überschreiten. Dies gilt insbesondere für die Steinbutt-Probe. Bei drei Portionen pro Woche liegt die Überschreitung der TWI zwischen 31 und 321 Prozent.
Insbesondere wenn Kinder Fisch- und Meeresfrüchte essen ist Vorsicht geboten. Denn bei geringerem Körpergewicht ist die PFAS-Aufnahme pro Kilogramm Körpergewicht höher. Bei einem Kind, das 13,5 Kilogramm wiegt, reicht beispielsweise bei 8 der 17 untersuchten Meerestieren bereits eine Portion von 50 Gramm pro Woche aus, um die TWI zu überschreiten.
Fazit: So belastet sind Meerestiere mit PFAS
Insgesamt liefert die Recherche deutliche Hinweise, dass Fische und weitere Meerestiere stark mit den persistenten PFAS-Chemikalien belastet sein können. Greenpeace weist jedoch darauf hin, dass die vorgelegten Ergebnisse lediglich auf 17 Stichproben basieren und möglicherweise nicht vollständig repräsentativ für das aktuelle Vorkommen von PFAS in Meerestieren aus der deutschen Nord- und Ostsee sein.
Die Umweltorganisation fordert dennoch ein umfassendes Verbot der Herstellung und Verwendung von PFAS. Dies solle verhindern, dass die Gesundheit von Menschen und Umwelt ernsthaft gefährdet würde.
Weiterlesen auf oekotest.de: