Leitungswasser aus dem Hahn trinken? Bei diesem Thema scheiden sich die Geister. Denn immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob Leitungswasser wirklich gesundheitlich unbedenklich ist. Darüber haben wir mit Jochen Kuckelkorn gesprochen. Er ist Biologe und Leiter der Toxikologie des Trink- und Badebeckenwassers im Umweltbundesamt. Ein Interview.
ÖKO-TEST: Das Umweltbundesamt hat bereits Hunderte Arzneimittelwirkstoffe in der Umwelt nachgewiesen, darunter Schmerzmittel wie Diclofenac, Antiepileptika, Betablocker, Blutdrucksenker, Antibiotika und sogar Röntgenkontrastmittel. Beobachten Sie auch eine Zunahme der Belastungen im Trinkwasser?
Jochen Kuckelkorn: Diese Beobachtungen gibt es. Aber das liegt vor allem daran, dass die chemische Analytik immer besser wird. Sie kann heute Spurenstoffe im Nanogrammbereich pro Liter Wasser nachweisen – das ist ein Milliardstel Gramm. Diese Stoffe waren vielleicht früher schon im Trinkwasser, wurden aber bisher nicht identifiziert und quantifiziert.
Jetzt entsteht in der öffentlichen Debatte der Eindruck, es seien sehr viel mehr gefährliche Stoffe im Trinkwasser enthalten. Aber es kommt auf die richtige wissenschaftliche Bewertung der Konzentrationen an.
Und die wäre?
Kuckelkorn: Wasserversorger messen durchaus verschiedene Substanzen wie Diclofenac, Carbamazepin oder Abbauprodukte von Wirkstoffen wie Oxipurinol oder Valsartansäure. Allerdings tauchen sie im Trinkwasser nur im niedrigen Spurenstoffbereich auf, also mit wenigen Nanogramm pro Liter.
Phenazon zum Beispiel, ein Schmerzmittel und Fiebersenker, wurde im Trinkwasser in Konzentrationen von 0,4 Mikrogramm pro Liter gemessen – ein Mikrogramm ist ein Millionstel Gramm. Da ist man weit von Wirkschwellen entfernt, selbst wenn man zwei Liter pro Tag zu sich nimmt.
Die therapeutische Tagesdosis für Erwachsene in Tablettenform beginnt bei 300.000 Mikrogramm – das ist der Faktor 375.000. Bei den meisten Wirkstoffen liegt das Verhältnis in einer ähnlichen Größenordnung.
Bei Oxipurinol etwa – dem aktiven Metaboliten des Gichtmittels Allopurinol – liegt der Anteil im Rohwasser bei 0,25 bis 1,6 Mikrogramm pro Liter, im Trinkwasser liegt er dann oftmals unterhalb der Bestimmungsgrenze. Da sind wir sehr weit von gesundheitlichen Folgen entfernt.
Die Analytik hat auch Wirkstoffe der Antibabypille im Trinkwasser nachgewiesen, Jugendliche kommen früher in die Pubertät …
Kuckelkorn: Da geht es um das synthetisch hergestellte Östrogen Ethinylestradiol. Aber auch das kommt in so niedrigen Konzentrationen in unserem Trinkwasser vor, dass es keinen Effekt auf uns Menschen haben kann. In der Umwelt haben wir da übrigens eine größere Besorgnis.
Bei Fischen und Kleinstlebewesen wurden schon klare Veränderungen von Lebensgemeinschaften gesehen, weil die Fortpflanzungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Ein Experiment in Kanada zeigte beispielsweise, dass die männlichen Tiere verweiblicht wurden und die Population während der Versuchsdauer zusammengebrochen ist.
Gibt es denn für das Trinkwasser engmaschige Kontrollen?
Kuckelkorn: Arzneimittel, Hormone und Antibiotikawirkstoffe sind kein Bestandteil der gesetzlichen Routineüberwachung der Wasserversorger, Gesundheitsämter und des Umweltbundesamts, da sie in der Trinkwasserverordnung nicht explizit aufgeführt werden. Daher haben wir keine durchgängigen, flächendeckenden Daten.
Dennoch überwachen die Wasserversorger ihre Ressource Wasser sehr genau, da im Trinkwasser grundsätzlich keine Substanzen enthalten sein dürfen, die gesundheitlich bedenklich sind. Und Versorger, die zum Beispiel große Krankenhäuser, Altenheime oder Viehbetriebe in ihrem Einzugsgebiet haben, kontrollieren das Wasser ohnehin gezielt auf diese Stoffe. Wenn Befunde auftauchen, binden die Versorger die Landes- und Kommunalbehörden sowie gegebenenfalls das Umweltbundesamt mit ein.
Also alles völlig unbedenklich?
Kuckelkorn: Unser Trinkwasser sollte natürlich rein sein. Diese Reinheit ist nicht gegeben, wenn etwa Pestizide, Arzneimittel oder andere Stoffe im Trinkwasser vorkommen. Doch man muss gut abwägen, welche Konzentrationen man tolerieren kann und wie hoch der Aufwand wäre, um Substanzen vollständig zu entfernen.
Dies ist meist nur durch teure, energieaufwendige Methoden wie die Umkehrosmose zu erreichen. Die hohen Investitions- und Betriebskosten stehen bei den sehr geringen und unbedenklichen Konzentrationen in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Allerdings nehmen die Spurenstoffe zu …
Kuckelkorn: Das ist richtig. Die Bevölkerung in Deutschland wird tendenziell älter, dadurch nimmt die Menge der verschriebenen Arzneimittel zu, und auch die Relation von Älteren zu Jüngeren verschiebt sich. Das heißt, es werden mehr Arzneimittel über einen längeren Zeitraum aufgenommen und ausgeschieden.
Sie sehen dennoch keine gesundheitlichen Risiken?
Kuckelkorn: Um es klar zu sagen: Die Trinkwasserversorgung in Deutschland ist sehr gut aufgestellt, und wir genießen eine sehr hohe Qualität. Wir haben bis heute keine besorgnis erregenden Konzentrationen im Trinkwasser – auch wenn in den sozialen Medien manchmal anderes behauptet wird. Wir erleben durch Social Media oft eine große Verunsicherung, weil leider viel Unsinn in der Welt ist und jemand damit Klicks generieren will.
Für Bürgerfragen stehen wir dabei immer zur Verfügung. Die Information ist Teil unserer Amtsaufgabe und wissenschaftlich orientiert. Man kann sich gern an uns wenden.
Worauf führen Sie die hohe Trinkwasserqualität zurück?
Kuckelkorn: Unsere Trinkwasserverordnung regelt explizit zahlreiche Parameter und sagt klar: Es dürfen grundsätzlich keine Stoffe im Trinkwasser vorhanden sein, die besorgniserregend wären.
Das Umweltbundesamt hat dazu Listen mit Trinkwasserleitwerten und gesundheitlichen Orientierungswerten für jene Stoffe aufgestellt, die schon mal im Trinkwasser aufgetreten sind. Diese haben wir bewertet, sie werden von den Wasserversorgern in ihrem Monitoring herangezogen und im Regelfall kontrolliert, damit sich die Konzentrationen der Stoffe unterhalb dieser Werte befinden.
Und werden diese Listen länger?
Kuckelkorn: Wir bekommen in der Tat gelegentlich Anfragen, wenn irgendwo ein Stoff gefunden wurde, für den es noch keine Bewertung gibt. Dann können wir in der Literatur oder in Studien großer internationaler Institutionen nachschauen und in unseren Laboren zeitnah gentoxische oder hormonelle Untersuchungen machen, um Schädigungen auszuschließen.
Wir kontrollieren auch, ob sich Substanzen, die derzeit in sehr niedrigen Konzentrationen auftreten, durch den stetigen Eintrag anreichern und vielleicht später in höheren Konzentrationen vorhanden sind, weil sie in der Umwelt oder den Kläranlagen schlecht eliminiert werden. Das werden wir weiter beobachten und auch die Aufbereitungstechnik weiterentwickeln.
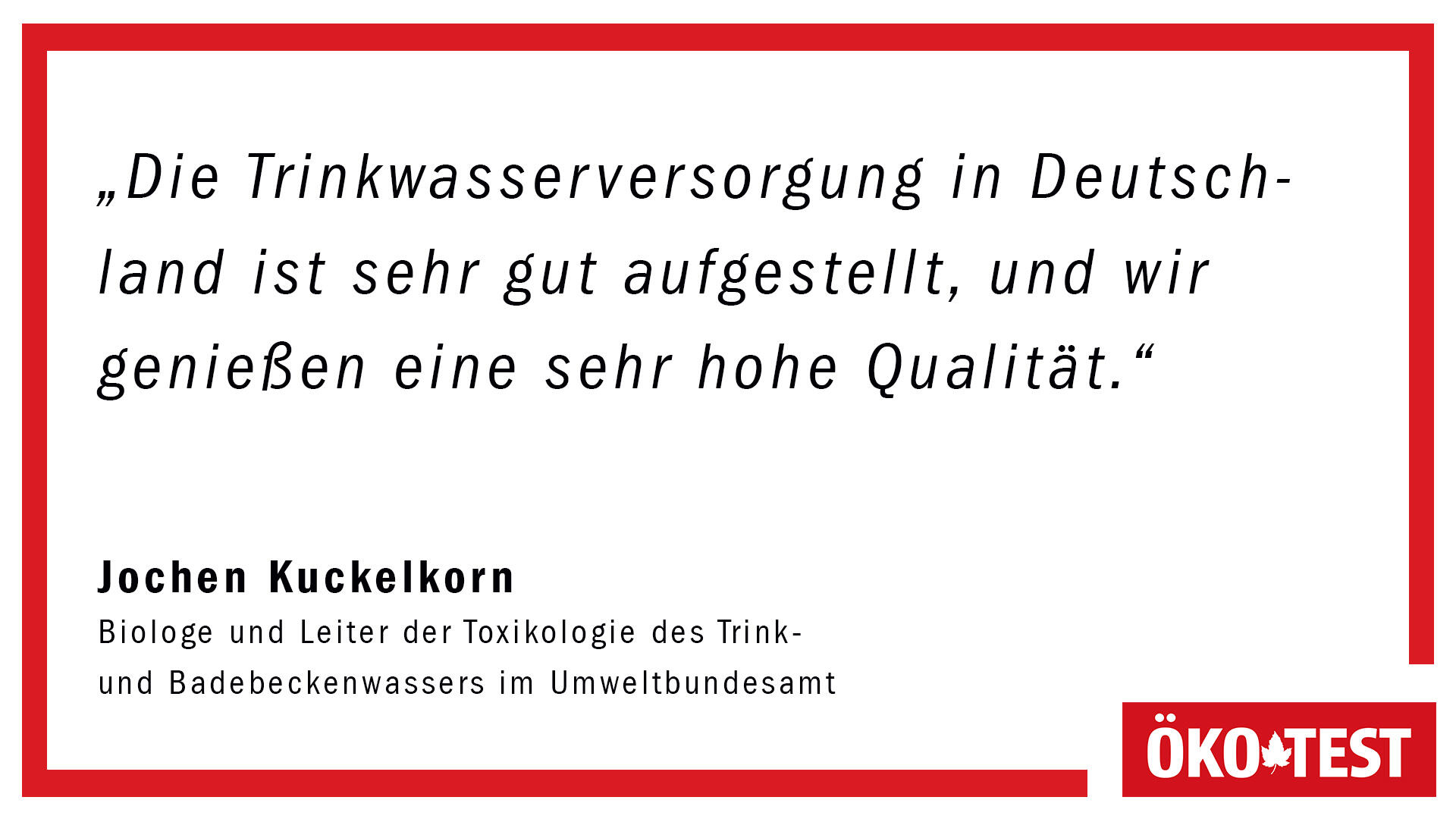
Gibt es denn auch Bestrebungen, der Spurenstoffe noch besser Herr zu werden?
Kuckelkorn: In der neuen Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) der EU spielt die vierte Reinigungsstufe in Klärwerken eine große Rolle, um mehr Spurenstoffe aus dem Wasser zu holen als in konventionellen Kläranlagen mit drei Reinigungsstufen.
Eine vierte Reinigungsstufe, zum Beispiel mit einer Ozonierung oder durch UV-Bestrahlung mit Aktivkohlefilterung, entfernt tatsächlich viele Spurenstoffe sehr effektiv. Das muss jetzt in den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden, wenn auch gestaffelt.
Zudem werden Wasserversorger jetzt verpflichtet, sich ihre Trinkwassereinzugsgebiete anzuschauen und eine umfassende Risikoabschätzung ihrer Ressourcen vorzunehmen. Das ist ein wichtiger Punkt, um die Qualität des Trinkwassers auch in Zukunft nachhaltig aufzustellen.
Wissen die Behörden generell, welche Wirkstoffe im Umlauf sind?
Kuckelkorn: Das Umweltbundesamt hat einen genauen Überblick über die in Deutschland zugelassenen Wirkstoffe. Die Hersteller müssen dazu umfassend Daten liefern. Derzeit sind in Deutschland mehr als 2.500 Wirkstoffe in der Humanmedizin im Verkehr, etwa die Hälfte davon ist relevant für eine Umweltrisikobewertung.
Zudem sind etwa 450 Wirkstoffe für Heim und Nutztiere zugelassen. Darüber hinaus gibt es aber auch Metaboliten, also Zwischen oder Abbauprodukte, die im Körper und in der Umwelt entstehen können. Das ist ein langer Rattenschwanz an Folgeprodukten.
Damit beschäftigen wir uns als Umweltbundesamt in Forschungsprojekten mit Universitäten, Wasserversorgern und der Industrie, um genau zu wissen: Was tritt vermehrt auf? Was muss man genauer anschauen? Wie funktioniert die Aufbereitung? Gibt es bei der Rohwasserqualität regionale Unterschiede?
Das hängt wie gesagt vor allem von den jeweiligen Belastungen im Einzugsgebiet eines Wasserversorgers ab. Und es hängt davon ab, welche Ressource genutzt wird: Grundwasser hat grundsätzlich niedrigere Konzentrationen als Oberflächenwasser. Durch die Bodenpassage werden viele Stoffe mikrobiell abgebaut und umgewandelt und dringen gar nicht erst in tiefere Schichten des Grundwassers vor.
Auf welchen Wegen geraten medizinische Rückstände überhaupt ins Trinkwasser – welche Rolle spielt die Pharmaindustrie?
Kuckelkorn: Die Industrie ist in Deutschland streng reguliert. Sie muss in ihren Werken eigene Kläranlagen vorhalten und Abwässer vorbehandeln, bevor sie sie in die Umwelt abgibt. Ein großer Anteil kommt von den Bürgern, die die Arzneimittel zu sich nehmen und einen Teil wieder ausscheiden. Oder die eine Salbe auf die Haut auftragen, deren Wirkstoffe durch das Händewaschen und Duschen in die Umwelt gelangen.
Zusätzlich werden in der intensiven Viehhaltung Antibiotika und andere Arzneimittel eingesetzt, um die Tiere gesund zu erhalten. Der Antibiotikaverbrauch bei Menschen und in der landwirtschaftlichen Tierhaltung ist ungefähr gleich groß.
Was können wir Menschen dazu beitragen, den Eintrag zu verringern?
Kuckelkorn: Eine einfache Grundregel sagt: Wischen statt Waschen! Schmerzsalben mit Diclofenac sollte man nicht mit Wasser abspülen, sondern nach der Behandlung seine Hände mit einem Tuch säubern und es im Restmüll entsorgen. Auch wenn es sich profan anhört: Dieses Vorgehen reduziert die Einträge enorm, weil die Mittel so eine große Verbreitung haben.
Sogar für Röntgenkontrastmittel, die gespritzt werden, gibt es Pilotprojekte: Den Patienten wird ein Auffangbeutel für den Urin mitgegeben. Der wird nach der Benutzung in der Arztpraxis wieder abgegeben und fachgerecht entsorgt, um die Gewässerbelastung zu reduzieren.
Generell sollten Restbestände von Medikamenten nicht in die Toilette gespült, sondern im Restmüll entsorgt oder zur Schadstoffstelle gebracht werden. Die Website arzneimittelentsorgung.de gibt dazu weitere, auch regionale Hinweise.
Sind denn Wasserfilter im Haushalt sinnvoll?
Kuckelkorn: Wir als Umweltbundesamt raten davon ab! Die Gefahr einer mikrobiellen Verkeimung, weil das Gerät unsachgemäß benutzt wurde, ist größer als der Nutzen, den man sich erhofft. Wir empfehlen lediglich, Kaltwasser für das Essen und Trinken zu verwenden.
Am besten den Kaltwasserhahn bis zum Anschlag zur Seite drehen und etwas Wasser ablaufen lassen, gerade wenn es über Nacht gestanden hat. Wenn es kühl ist, kann man das Wasser bedenkenlos trinken.
Weiterlesen auf oekotest.de:











