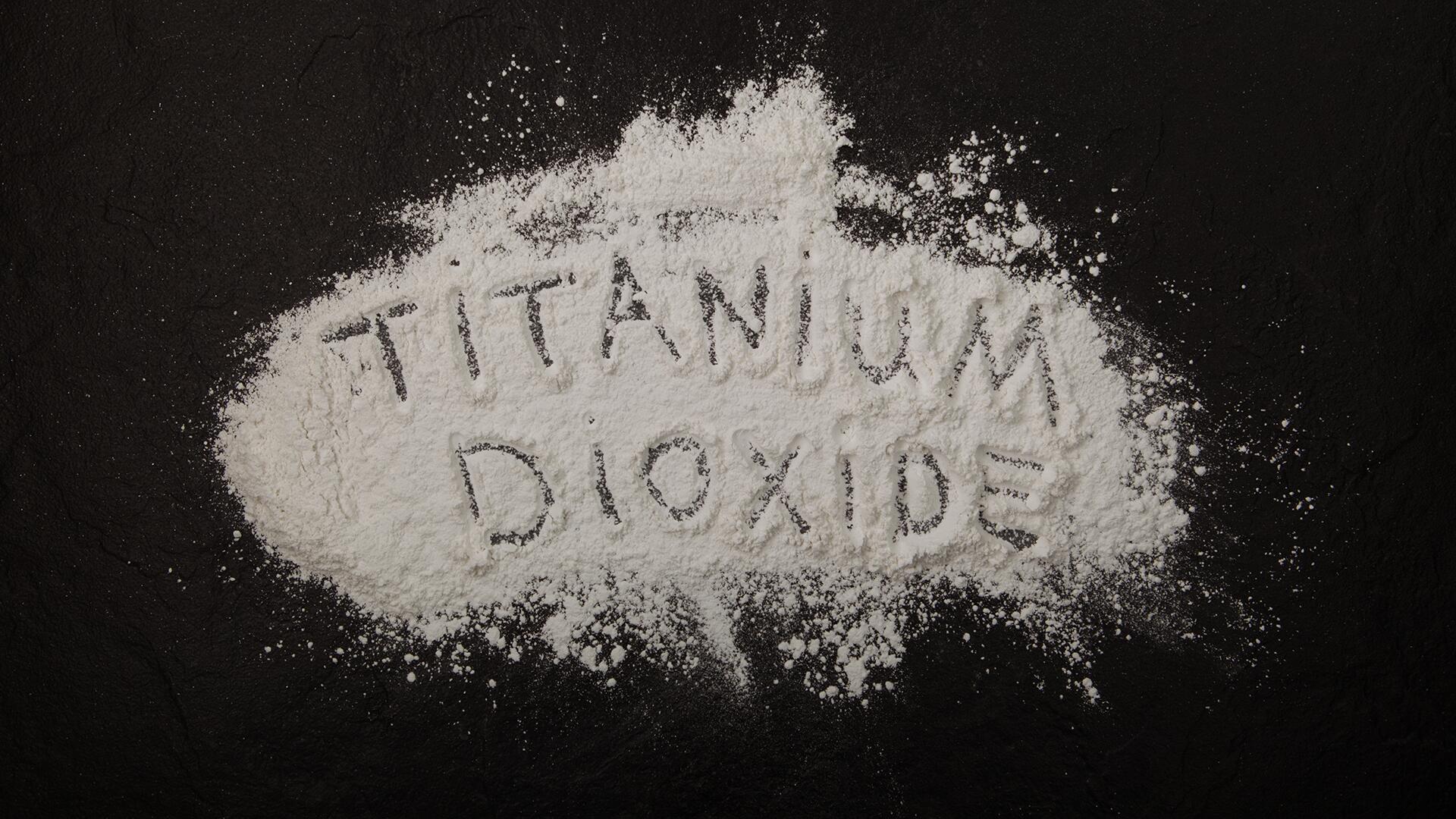Titandioxid ist ein kontrover diskutierter Inhaltsstoff. In Lebensmitteln galt er lang als harmloser Zusatzstoff. Und noch heute verleiht Titandioxid Medikamenten ihre strahlend weiße Farbe. Es steckt außerdem in Papier, in Wandfarben, Lacken, Baustoffen und Kosmetika.
Seit August 2022 ist Titandioxid als Zusatzstoff E 171 in Lebensmitteln verboten. Grund: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) konnte den Stoff nicht mehr als sicher einstufen und eine erbgutverändernde Wirkung nicht ausschließen.
In Pulverform war Titandioxid schon 2020 von der EU-Kimmission als "vermutlich krebserzeugend beim Einatmen" eingestuft worden. Mehrere Industrievertreter klagten dagegen und es folgte ein Rechtsstreit, ob die Einstufung zulässig bleibt oder nicht. Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH), das höchste EU-Gericht mit Sitz in Luxemburg, die damalige Entscheidung für ungültig erklärt.
Farben mit Titandioxid mussten Warnhinweis tragen
Aber nochmal von vorn: Bereits im Jahr 2017 hatte der Ausschuss für Risikoeinschätzung (RAC) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) Titandioxid als potenziell krebserregend beim Einatmen bewertet. Die EU-Kommission erließ daraufhin im Oktober 2019 eine Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung von Titandioxid. Damit wurde der Stoff im Februar 2020 in die CLP-Verordnung (EG) Nr. 1271/2008 aufgenommen; diese regelt die EU-weite Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien.
Mit dieser seit 2020 geltenden Einstufung wurden Pulvergemische, die mindestens ein Prozent Titandioxid in einer Partikelgröße von zehn Mikrometern oder weniger enthalten, zwar nicht verboten. Sie mussten aber fortan den Warnhinweis "Karzinogen beim Einatmen" tragen. Das galt vor allem für sprühbare Gemische wie Farben und Lacke, die einen lungengängigen Sprühnebel erzeugen können.

Gericht kritisiert methodische Schwächen
Verschiedene Hersteller, Importeure und Lieferanten legten Klage gegen diese Einstufung ein – und bekamen Recht. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) erklärte die Einstufung von 2020 für nichtig. Die Begründung: Die zugrunde liegenden wissenschaftlichen Studien weisen methodische Schwächen auf. Kritisiert wird etwa, dass die Lungenüberlastung und die Partikeleigenschaften nicht ausreichend berücksichtigt worden seien.
Zudem sei ein Verstoß gegen die CLP-Verordnung begangen worden: Um als krebserregend eingestuft zu werden, müsse Titandioxid die "intrinsische Eigenschaft" besitzen, Krebs zu erzeugen. Es müsste also für sich genommen krebserregend sein. Der Ausschuss für Risikobeurteilung der Chemikalienagentur habe die Gefahr von Titandioxid aber als "nicht intrinsisch im klassischen Sinn" eingestuft.
Ein krebserzeugendes Potenzial von Titandioxid ist laut Gericht nur unter sehr spezifischen Bedingungen gegeben, zum Beispiel wenn lungengängige Partikel in großen Mengen eingeatmet werden und zugleich eine Überlastung der Lungenreinigungsfunktion besteht.
Gegen das EuG-Urteil von 2022 legte zuerst Frankreich, dann auch die EU-Kommission selbst Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein, jedoch erfolglos. Der EuGH hat nun am 1. August 2025 die Entscheidung des Europäischen Gerichts (EuGH) von 2022 bestätigt. Somit bleibt die Einstufung von Titandioxid in Pulverform als "vermutlich krebserzeugend beim Einatmen" nichtig.
Titandioxid belastet Mensch und Natur
"Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs war erwartbar", sagt Dr. Jürgen Steinert, stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Testressorts bei ÖKO-TEST. "Die wissenschaftlichen Belege haben wohl nicht ausgereicht, dass die krebserregende Wirkung beim Einatmen tatsächlich auf das Titandioxid zurückzuführen ist", resümiert er.
Dabei schreibt das Bundesinsitut für Risikobewertung (BfR), dass das höchste Risiko für eine potenzielle Titandioxid-Aufnahme bei der Inhalation besteht. Dies betreffe lungengängige Partikel, die kleiner als zehn Mikrometer sind, und Nanopartikel.
"Stäube mit sehr kleinen Partikeln wie Feinstaub sind generell nichts Gutes für die Gesundheit. Es ist bekannt, dass sie tief in die Lunge gelangen können. Sie belasten außerdem nicht nur den Menschen, sondern auch die Natur", sagt ÖKO-TEST-Testchef Steinert.
Warnhinweis-Pflicht für Farbeimer
Farbeimer mussten bisher einen Warnhinweis tragen, wenn sie mehr als 1 Prozent Titandioxid enthalten. Dieser lautet: "Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen."
Auch wenn Titandioxid nicht länger als krebserregend beim Einatmen eingestuft wird, wäre es aus Sicht von ÖKO-TEST dennoch wünschenswert, dass die Warnhinweise für Sprühanwendungen weiterhin bestehen blieben – allein schon deshalb, weil es die Studien, die bei der damaligen Einstufung herangezogen wurden, nun einmal gibt.
Übrigens: Ist Titandioxid in flüssigen oder getrockneten Farben gebunden, stellt es keine Gefahr dar. Ein Risiko besteht "nur" beim Einatmen.
Wie ÖKO-TEST Farben und Lacke mit Titandioxid bewertet
Bisher hat ÖKO-TEST es nicht abgewertet, wenn Heimwerkerprodukte wie Wandfarben oder Lacke Titandioxid enthalten. Bei flüssigen Farben wird auch weiterhin keine Abwertung erfolgen. "Es ist unwahrscheinlich, dass beim Streichen mit der Rolle oder dem Pinsel Titandioxidpartikel in die Lunge gelangen", erklärt ÖKO-TEST-Testressortleiter Dr. Jürgen Steinert. Wer die Farbe doch aufsprüht, sollte vorsichtshalber einen Atemschutz tragen. Das gilt auch fürs Abschleifen.
Anders sieht das bei Sprays aus, wie Sprühfarben oder -lacken. "Hier wäre es sinnvoll, künftig zu testen, wie es um mögliche lungengängige Partikel, darunter auch Titandioxidpartikel, steht."
Gut zu wissen: Wer Farben kauft und in der Liste der Inhaltsstoffe nach Titandioxid Ausschau halten will, wird es möglicherweise nicht finden. Denn der Stoff ist dort nicht immer deklariert. Stattdessen wird er etwa als "mineralisches Weißpigment" aufgeführt. Die konkrete Bezeichnung ist aber im Technischen Informationsblatt aufgelistet. Übrigens ist Titandioxid auch oft in farbigen Wandfarben enthalten, und nicht nur in weißer Farbe.
Titandioxid: Weitere Verbote sind wünschenswert
ÖKO-TEST begrüßt es, dass Titantioxid im August 2022 in Lebensmitteln verboten wurden. "Wünschenswert wäre aber auch ein Verbot in Medikamenten und in Kosmetikprodukten, die oral aufgenommen werden, wie Zahnpasta und Lippenstiften", sagt Steinert.
Ob es hier ebenfalls zu einem Verbot kommt, ist noch unklar. Eine neue Einschätzung von Titandioxid in Medikamenten steht noch aus. Auch für oral aufgenommene Kosmetikprodukte ist eine erneute Sicherheitsbewertung geplant – dabei kam das zuständige wissenschaftliche Gremium (SCCS) der EU-Kommission schon im Dezember 2023 zu dem Schluss, dass ein erbgutverändertes Potenzial auch für solche Kosmetika nicht ausgeschlossen werden kann.
Aus Sicht von ÖKO-TEST hat Titandioxid nichts in Medikamenten sowie in Kosmetikprodukten, die über den Mund in den Körper gelangen können, zu suchen. Daher werten wir den Inhaltsstoff in solchen Produkten ab. Wir ziehen aber keine Noten ab, wenn Titandioxid als UV-Filter in Sonnencreme eingesetzt wird. Denn nach aktuellem Stand geht kein Risiko davon aus, wenn das Pigment beim Eincremen auf gesunde Haut aufgetragen wird.
Weiterlesen auf oekotest.de:
- Weiße Wandfarben im Test: Welche Kalk- und Dispersionsfarben sind empfehlenswert?
- Zahnpasta-Test: Immer noch Titandioxid in 13 von 48 Zahncremes
- Lippenstifte-Test: Titandioxid und Mineralölrückstände auf den Lippen
- Fast alle Lipglosse im Test enthalten Titandioxid – Weshalb das ein Problem ist
- Nach Verbot in Lebensmitteln: Bleibt Titandioxid in Medikamenten?